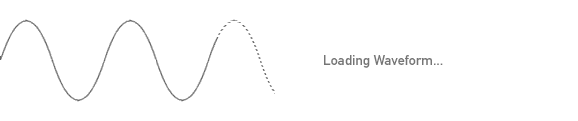„Victim blaming“: Ein Plädoyer.
Victim blaming, die „Täter-Opfer-Umkehr oder Schuldumkehr … ist die Beschreibung für ein Vorgehen, das die Schuld des Täters für eine Straftat dem Opfer zuschreiben soll.“ (wikipedia) Motto: Gegen die Tabuisierung des „victim blaming“! Die Rechtfertigung benennt das Motiv des Täters, und damit den praktisch wirksamen Grund der Tat.
„Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstdefinition“:
Ganz normale Psychos betreiben mentale Selbstoptimierung!
Ein etwas anders akzentuierter psychologischer Zugang stammt von Heidi Kastner in dem Buch „Tatort Trennung“, an dem entlang ich weiter diskutieren möchte; Kastner bleibt näher am Thema, aber auch in ihrer Darstellung ist mehr referiert, als erklärt:
„Trennungswünsche, vor allem wenn sie eher unerwartet vom Partner in den Raum gestellt werden, sind immer mit extremer Kränkung verbunden, weil sie eine nachhaltige Erschütterung der Selbstdefinition durch einen bedeutsamen anderen darstellen. Wo man sich zuvor noch gebraucht, beheimatet, vielleicht sogar geliebt wähnte, wird nun mitgeteilt, dass man entbehrlich, verzichtbar und überflüssig ist und dass der andere sich sein weiteres Leben sehr gut ohne einen vorstellen kann. Diese Verschiebung der tektonischen Platten unserer Existenz entzieht uns zumindest für eine gewisse Zeit den Boden …“ (Heidi Kastner,
„Tatort Trennung” S. 51)
Die „Selbstdefinition“ ist durch eine Trennung „nachhaltig erschüttert“, weil sie eine „extreme Kränkung“ beinhaltet. Das ist m.E. eben gar nicht so selbstverständlich, auch wenn es öfter vorkommt. Festzuhalten ist mal, diese Selbstdefinition kommt entgegen der Wortbedeutung nicht aus dem hochpersönlichen „Selbst“, sie wird von jemand „bedeutsamen anderen“ geliefert bzw. dann verweigert. Aber warum lässt die Mitteilung der Entbehrlichkeit und Verzichtbarkeit deren Empfänger gleich in eine existenzielle Krise entgleisen, und warum drängt sich so manchem dann die Gewalt als adäquate Antwort auf? Man war „gebraucht, beheimatet, geliebt“, nachher ist man „entbehrlich, verzichtbar, überflüssig“ – sicher schmerzlich, aber diese Änderung „entzieht uns den Boden“, es verschieben sich die „tektonischen Platten unserer Existenz“!? Stellt sich die Frage: Wenn dem so ist – was war diese „Selbstdefinition“ vorher? Klar, eine Trennung erschüttert sehr viel; vielleicht muss das ganze Leben enorm umorganisiert werden – ich versuche diese Situation mal möglichst sachlich einzufangen. Man ist für die künftige „Ex“ also „überflüssig“ – aber ist man deswegen insgesamt überflüssig, wieso steht gleich die komplette „Existenz“ in Frage? Man wähnte sich „beheimatet“ und „gebraucht“, aha – soll heißen, man wusste, wo man hingehört im Leben, in der ganz diffusen und u.U. sehr anspruchsvollen Bedeutung von „beheimatet“ … Aber in dem Punkt vernachlässigt Kastner eine für anständige Menschen selbstverständliche Konsequenz des überhaupt nicht selbstlosen Bedürfnisses, gebraucht zu werden. Denn das beinhaltet in der Regel den durch dieses gebraucht-werden verdienten Anspruch auf die Brauchbarkeit des jeweiligen Gegenüber, dieses hätte wegen je eigener Leistungen schon reziprok zur Verfügung zu stehen. Und dieser Anspruch auf den bzw. die andere – der ist erledigt, und das erschüttert offenbar alles.
Selbstdefinition, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein? Worum geht es da? Gemeint ist i.d.R. nicht die triviale Tatsache, dass man ein Bewusstsein seiner selbst hat, im Unterschied zur Umgebung. Man weiß, wer man ist, was man will und kann oder auch nicht kann und nicht will, und man weiß auch, dass man es weiß … Gemeint mit „Selbstbewusstsein“ist normalerweise aber, man habe eine sehr gute, womöglich eine hervorragende Meinung von sich selbst, man hält große Stücke auf sich, man hält sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für erfolgreich und daher auch zurecht für allgemein angesehen. Kurz: Man ist stolz auf sich! Es geht um die Bedeutung dessen, was ein von Trennung Betroffener formuliert hat, wenn er sagt, er „fühlte sich verloren, er wusste nicht mehr, wer er war, als Person, Vater und Mann“ – er hat gezweifelt, ob er als Person, als Vater und Mann tatsächlich so weit oben im Leben angekommen war, wie er es sich bis dahin eingebildet hat. Es hat sich zwar an ihm, an seiner Person – an seinen Fähigkeiten, Kompetenzen etc. als auch an seinen Bedürfnissen – nichts geändert, er hat aber offenkundig das gehobene Selbstbewusstsein, er sei einer, der letztlich im Leben triumphiert hat, der „es geschafft hat“ im weitesten Sinn – das hat er an Frau und Kindern festgemacht, und verloren. Sein Stolz auf sich selbst liegt in Trümmern. Offenbar hat im modernen Beziehungswesen das jeweilige Gspusi die hohe, edle und existentielle Aufgabe, den entscheidenden, letztgültigen Beweis des Erfolgs im Leben abzuliefern, auf den der Partner doch wohl ein Recht hat, vor allem weil er seinerseits auch „alles“ für die Partnerin zu tun bereit ist, seiner Meinung nach.
Manche psychologische Interpretation besagt nun, dass man sich so ein Selbstwertgefühl in der Kindheit durch das richtige Quantum „emotionaler Muttermilch“ einfängt oder auch nicht, und dann sein Lebtag damit versorgt ist, oder eben nicht. Im richtigen Leben geht es anders zu, da kämpfen Leute durchaus bewusst und als Daueranstrengung darum, sich selbst „beweisen“ zu wollen, wie toll sie nicht sind, und das nicht nur im Berufs-, sondern bevorzugt und sogar endgültig im Privatleben. Deswegen ist ein Beziehungsende öfter auch die ultimative, die nicht zu verkraftende Demütigung und Demolierung der Persönlichkeit, wofür sich dann einige Leute bitter rächen. Altertümlich: Die Ehre ist zerstört. Alles, was respektabel, bedeutend, liebenswert ist – Mann, Vater, Kamerad, Sex-Partner, überhaupt die eigene Attraktivität und damit der Wert der Person – das ganze Ich ist bestritten:
„Die Annahme, betrogen zu werden, geht einher mit der Annahme, nicht so einzigartig, liebens- und begehrenswert zu sein, wie man sich das wünscht, sodass sich die Eifersucht vor allem als Bestätigung mangelnden Werts, als Ausfluss fehlenden Selbstwerts und damit als Angriff auf die Basis der psychischen Funktionsfähigkeit und inneren Stabilität darstellt. Die Abwehr diese Angriffs kann über mehr oder weniger reife Mechanismen erfolgen; einer davon ist die Entwertung des anderen, der einen ‘nicht verdient’ hat, der Zuneigung oder Liebe gar nicht wert war … ein leider nicht so seltener Weg ist die Vernichtung desjenigen, der mich über seinen Betrug entwertet und gedemütigt hat: … Die Wahrscheinlichkeit, zum Mordopfer zu werden, ist in Beziehungen am höchsten, vier Fünftel aller Tötungsdelikte …“ (ebd. S. 78f.)
Was die Partnerin also bestätigt hat und weiter hätte bestätigen sollen – oder müssen? – nämlich „einzigartig, liebens- und begehrenswert zu sein“, das schlägt um in die „Bestätigung mangelnden Werts, des fehlenden Selbstwerts“ – und das ist, sofern als niederträchtige Absicht interpretiert, ein gemeiner „Angriff auf die Basis der psychischen Funktionsfähigkeit und inneren Stabilität“. Weil ihre (der „Ex“) praktizierte, als Beziehung existierende Anerkennung und ihre Bewunderung offenbar das Fundament seiner psychischen Stabilität war. Diese Wirkung der Trennung auf den dadurch endgültig gescheiterten Selbstbewusstseinspflegefall, die wird ab und an als Vorsatz gedeutet.
Diese „Selbstdefinition“, dieser „Selbstwert“ ist aber nicht nur eine Kategorie aus der Welt der akademischen Psychologie, ein bloß theoretisches Vehikel zur Erläuterung psychischer Zustände, das den davon Betroffenen vielleicht gar nicht in der vollen Tragweite bewusst und geläufig ist. Es handelt sich vielmehr um eine sehr praktisch verfolgte mentale Zusatzanstrengung sehr normaler Konkurrenzsubjekte im bürgerlichen Getriebe: In der modernen Welt voll von freischaffenden Amateurpsychologen in permanenter Selbsttherapie, die – medial durch Profis angeleitet – sich selbst zum Erfolg, zum Glück oder wenigstens zur Zufriedenheit hinmanipulieren wollen. Essentiell dafür ist, man muss bekanntlich fest „an sich glauben“, ein bombensicheres „Selbstbewusstsein“ entwickeln und behalten, als unabdingbare Voraussetzung, um überhaupt handlungsfähig zu sein, vielleicht sogar als das entscheidende Mittel, um erfolgreich zu sein. Das wird gelebt und erlebt, und ab und an heimgezahlt, wenn diese Autosuggestion mit der leichten Tendenz zum Selbstbetrug durch eine Trennung auffliegt: Diese voreingenommene, interessengeleitete, fast zwanghafte Interpretation des je eigenen Lebens als einer Veranstaltung, die unbedingt als gelungen zu bilanzieren ist, wodurch der Beweis des berechtigten Stolzes auf einen selber erbracht wäre – was als Ausgangslage eben die Zweifel unterstellt; wer hat es denn nötig, sich ständig selber hochzujubeln?! („glaubandich“ – das wird heutzutage schon kleinen Kindern von der Werbekampagne einer Bank empfohlen! Kriegen die Kleinen dann einen günstigen Kredit?)
Die Familie – Ort des Glücks!
Fragt sich noch, warum ausgerechnet das Privatleben die entscheidende, die in dieser Kultur empfohlene Bastion dieser „ich-bin-stolz-auf-mich“ Bedürfnisse ist? Ein paar mehr oder weniger reale Anhaltspunkte und Bestätigungen im richtigen Leben braucht dieses Selbstbewunderungsbedürfnis offenbar schon, damit die Protagonisten munter weiter „an sich glauben“ können. Kastner erwähnt den Aufstieg des Bürgertums mit der „Fokussierung“ auf das „häusliche Glück“:
„Mit dem Aufstieg des Bürgertums (und der Romantik) wurde das fatale Ideal der eierlegenden Wollmilchsau in die Welt gesetzt: Ehe, Liebe und Sexualität sollten in Kombination gelebt werden können. … Was nun ebenfalls folgte, war die Fokussierung auf das ‘häusliche Glück’, auf das traute Ehe- und Familienleben und die Kleinfamilie … Hochgesteckte Erwartungen bergen den Keim tiefer Enttäuschung in sich, überzogene Idealvorstellungen lassen die alltägliche Realität bald kümmerlich wirken und degradieren eine unspektakuläre, aber auch nicht sonderlich triste Lebenssituation zu einem Scheitern des eigenen Lebensplans.“ (ebd. S. 19 f.)
Diese „eierlegende Wollmilchsau“ ist die bürgerlich-normale Verabsolutierung von Liebe, Beziehung, Sex, Frau, Familie zum Sinn des Lebens, zum Glück, zur Erfüllung schlechthin. Da hat einer nicht ein Interesse, ein Bedürfnis, also ein bestimmtes – und damit ein begrenztes – Anliegen neben anderen, sondern das ist das einzige, das zählt im Leben. Alles andere ist im Grunde genommen unbedeutend, eine Last, unangenehme Verpflichtung; Beruf, sonstige Interessen, Hobbies, Bedürfnisse welcher Art auch immer –, das taugt alles nicht viel. Und das eintönige Leben kann vollständig so bleiben, wie es ist – uninteressant, untauglich, anstrengend. Aber dadurch, dass etwas dazukommt – im Wesentlichen eine Frau, eventuell auch Kinder – dadurch ändert sich alles, dadurch kippt die Tristesse doch noch ins Positive. Und diese verwegene Stellung zur Welt ist keine individuelle Spinnerei, diese Attitüde gehört zur Grundausstattung empfohlener bürgerlicher Lebensart und Leitkultur, oder: „Die Familie ist das wichtigste!“ Diese „Fokussierung“ aller positiver Erwartungen auf das „häusliche Glück“ lebt von einer ebenso abstrakten wie radikal negativen Einschätzung des Alltags. Da legen Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft einen brutalen Realismus an den Tag, ohne dass damit eine Kritik am oder eine Absage an den „Alltag“ – im Kapitalismus – formuliert wäre. Der gilt bekanntlich auch als „Ellenbogengesellschaft“, es geht darum, sich durchzusetzen, zu kämpfen, etwas leisten zu müssen in Abhängigkeit von den Interessen anderer, ist eine Sphäre von Anstrengung mit ungewissem Erfolg. Bilder vom „Hamsterrad“ und von der „Tretmühle“ sind üblich, der „Stress“ als normale Begleiterscheinung und die Gefahr des „burn-out“ sind bekannt und anerkannt. – Die Familie und das Privatleben firmieren in dem Weltbild buchstäblich als Gegenwelt zu Anstrengung, Konkurrenz und Leistung; als die Sphäre, wo endlich das Individuum zählt, wo es um seiner selbst willen geschätzt wird und gut aufgehoben ist. Es ist jene Sphäre, die für all das entschädigen soll, was man sich außerhalb abverlangen und gefallen lassen muss. Glücksansprüche und Sehnsüchte „fokussieren“ sich auf diese Sphäre, und führen im Fall des Falles Erschütterungen herbei, die sich gewaschen haben. Wenn diejenige Abteilung des Lebens, die für die „work-life-balance“ sorgen soll, die also nichts weniger als das ganze Leben doch noch ins Lot bringen soll – wenn die scheitert, dann resultiert daraus am Ende öfter nicht nur der trauernde „Single“ und eine etwas „unspektakuläre, aber auch nicht sonderlich triste Lebenssituation“, sondern dann scheitert der ganze „Lebensplan“: Alles kaputt!
Diese „überzogenen Idealvorstellungen“ werden an die „Privat“-Abteilung des Lebens delegiert, die allemal als Anhängsel und Mittel des Erwerbslebens kenntlich ist. Die kriegt nun die Last des ganzen Lebens aufgebürdet, paradoxerweise: Denn was man sich – allein oder zu zweit – „privat“ überhaupt finanziell leisten kann und leisten muss, hängt doch daran, wie viel in der „Arbeitswelt“ verdient wird; wie lange man dafür beansprucht wird; wie geschafft man nachher physisch und psychisch ist; und was alles noch erledigt werden muss in der freien Zeit, bloß um am nächsten Tag wieder geschnäuzt und gekampelt antreten zu können! Und nachdem die Privatsphäre nicht selten aus einer Paarbeziehung besteht, kriegt niemand anderer als das geliebte Gegenüber eben diese Last des ganzen Lebens aufgebürdet. Noch einmal Kastner, die das Streben nach Glück skeptisch sieht und ein wenig zurückstufen möchte:
„Nicht Glück, sondern das Streben danach zählt zu den Menschenrechten, und ‘Streben’ impliziert immer eigene Anstrengung und unsichere Ergebnisse. Wo Individualisierung, Selbstverwirklichung und individuelles Glück zum höchsten Ideal erklärt werden, ist es allerdings nicht weiter verwunderlich, dass die Bedachtnahme auf andere abnimmt.“ (ebd. S. 45)
Stimmt schon, jedes „Streben“ impliziert Anstrengung, und Erwartungen können enttäuscht werden. Aber nach allen gültigen Maximen der bürgerlichen Gesellschaft ist ein jeder dann seines redlich verdienten „Glückes“ „Schmied“, wenn er es richtig anpackt, nämlich sich gehörig anstrengt. Wer seine Leistungen bringt, im Beruf und dann im Privatleben, wer im Rahmen der Familie bereit ist, „alles“ für andere zu tun, der erwirbt den Anspruch, diese anderen hätten es gefälligst genauso zu halten. Der anständige Mensch als solcher ist ein Recht-Haber, er hat nicht nur Bedürfnisse, die auf Zustimmung oder Ablehnung treffen können, er hat ein Recht auf Zuspruch „seiner“ Frau – und dadurch ist er im Fall der Trennung ein Opfer, das reingelegt wurde, „betrogen“ wurde um legitime Ansprüche. Denn das hat jeder ambitionierte Schmied seines Glückes kapiert: Wenn man oder Mann etwas will, etwas haben oder erreichen will, dann muss man sich das, was man will, auch verdienen, man braucht das entsprechende Recht – aber wenn dieses erworben wurde, wenn man sich die Zuwendung, die Beziehung, die Frau verdient, vielleicht „erobert“ hat, dann gibt es kein Halten, dann gilt das eigene Bedürfnis absolut. Das Recht ist das nicht kompromissfähige Interesse, es duldet keine Ablehnung. (Populär: „Ich akzeptiere kein Nein!“) Wo „individuelles Glück zum höchsten Ideal“ wird, da nimmt die „Bedachtnahme auf andere“ sicher nicht ab – diese anderen sind ja als Lieferanten des Glücks verplant und verpflichtet. Wenn einem dieses vorenthalten wird, dann schreit diese Ungerechtigkeit – aus der Sicht eines gutbürgerlich Wahnsinnigen – nach Rache, und wenn es das letzte ist, was einer tut; sein Leben ist ja ohnehin sinnlos und vorbei. Weswegen mancher sich dann nachher selbst bei der Polizei meldet.
Diese zwei Momente – der absolute Stellenwert von Frau bzw. Familie und Beziehung als Inbegriff des Glücks, und die Vorstellung eines Rechtsanspruchs darauf –, die sind Allgemeingut, das sind kulturell empfohlene Phänomene des hiesigen way of life und keine Spinnereien von ein paar Verrückten. Darin sind sie der Treibstoff der „Tragödien“ schlechthin. Eine schlussendliche Trennung, eine Verweigerung trifft den Verlassenen folgerichtig mitten in die Identität, sie kränkt sein Selbstwertgefühl, seine persönliche Ehre, indem er als Versager bloßgestellt wird, indem seine „Selbstdefinition“ als ein zum Erfolg berechtigtes und befähigtes Individuum blamiert ist: Die Beziehung, also die „Ex“, hätte doch die Verpflichtung gehabt, seinen – mal im Psychologendeutsch ausgedrückten – berechtigten Narzissmus zu beglaubigen, sein Recht auf seinen Stolz auf sein Leben und damit auf sich zu unterfüttern! Die meisten werden dann mit ihrem Kummer halbwegs fertig, andere gleiten in die Depression ab, und eine radikale Minderheit übt Rache für diese einfach nicht auszuhaltende Schmach. (Fortsetzung in Teil 3: Ein Beispiel für letztere Variante.)